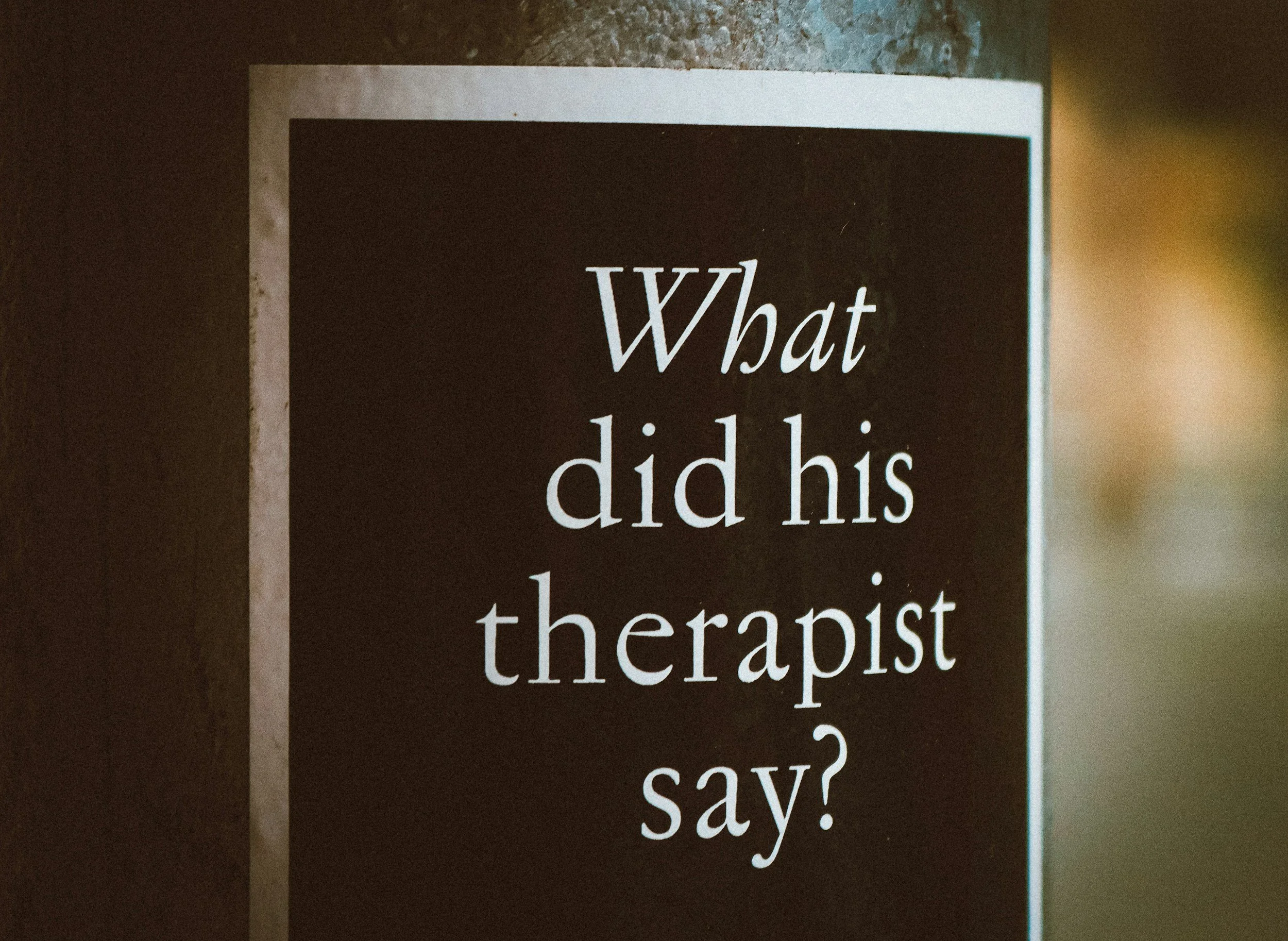In den letzten Wochen habe ich unterschiedliche psychische Krankheitsbilder vorgestellt, die alle gemeinsam haben, dass sie sich über körperliches Leiden Ausdruck verleihen. Du erinnerst dich vielleicht an die dissoziativen Störungen, einen Schutzmechanismus, der unser Bewusstsein vor oft schweren Traumata schützt, die somatoformen Störungen, bei denen die Seele über unterschiedliche Schmerzen und Erkrankungen über den Körper spricht, ohne dass eine körperliche Ursache gefunden werden kann, und schließlich die psychosomatischen Erkrankungen, bei denen der Körper mit einer Erkrankung reagiert, die im Kontext längerer Be- oder Überlastung steht.
Wenn Menschen mit entsprechenden Beschwerden in eine Therapie kommen, bringen sie oft eine lange Geschichte mit. Viele Arztbesuche. Untersuchungen. Medikamente. Vielleicht sogar die Erfahrung, nicht wirklich ernst genommen zu werden. „Organisch ist nichts zu finden.“ Dieser Satz kann für Betroffene gleichzeitig erleichternd und zutiefst frustrierend sein. Denn die Schmerzen sind real. Die Erschöpfung ist real. Das Herzrasen, die Magenkrämpfe, die Verspannungen, der Schwindel – all das ist spürbar, belastend und oft lebensbestimmend.
Der hypnosystemische Ansatz von Gunther Schmidt eröffnet hier eine spannende Perspektive. Eine Perspektive, die weder Körper noch Psyche gegeneinander ausspielt, sondern beide als Teile eines intelligenten, miteinander kommunizierenden Systems versteht. Und genau dort beginnt eine Form von Therapie, die nicht gegen Symptome kämpft – sondern versucht zu verstehen, wofür sie stehen.
Körper und Psyche: Zwei Sprachen desselben Systems
In vielen medizinischen und therapeutischen Modellen wird noch immer unterschieden zwischen „körperlich“ und „psychisch“. Der hypnosystemische Ansatz stellt diese Trennung infrage.
Gunther Schmidt verbindet zwei große therapeutische Traditionen:
Systemische Therapie
Hypnotherapie nach Milton Erickson
Aus dieser Verbindung entsteht ein Verständnis des Menschen als komplexes Selbstorganisationssystem. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Körperempfindungen, Beziehungserfahrungen und Verhaltensmuster wirken darin ununterbrochen zusammen. Der Körper ist in diesem Modell nicht einfach ein „Ort von Symptomen“. Er ist ein hochsensibles Resonanzsystem, das Erfahrungen speichert, bewertet und kommuniziert. Gerade bei psychosomatischen, somatoformen oder dissoziativen Symptomen zeigt sich das besonders deutlich. Was sich im Körper ausdrückt, ist oft eine Form von innerer Kommunikation, für die bislang keine andere Sprache gefunden wurde.
Symptome als sinnvolle Lösungsversuche
Ein zentraler Gedanke in Gunther Schmidts Arbeit ist zunächst irritierend – und zugleich zutiefst entlastend: Symptome sind keine Fehler. Sie sind Versuche des Organismus, mit Belastungen umzugehen. Das bedeutet nicht, dass Symptome angenehm oder hilfreich sind. Aber sie erfüllen häufig eine wertvolle und wichtige Funktion innerhalb des Systems.
Ein Beispiel:
Ein Mensch erlebt über lange Zeit starke innere Spannungen oder ungelöste Konflikte. Der Körper reagiert vielleicht mit chronischen Muskelverspannungen, Magenbeschwerden oder Herzrasen. Aus hypnosystemischer Sicht ist das kein „Defekt“. Es ist ein Regulationsversuch des Nervensystems. Der Körper versucht, mit den verfügbaren Mitteln Stabilität herzustellen.
Wenn Therapeut:innen beginnen, Symptome nicht als Gegner zu betrachten, verändert sich sofort die Haltung in der Therapie. Statt zu fragen: „Wie bekommen wir das weg?“ entsteht eine andere Frage: „Wofür könnte dieses Symptom eine Lösung sein?“ Allein diese Perspektivverschiebung kann für Betroffene eine enorme Entlastung sein. Denn plötzlich wird ihr Erleben nicht mehr als Problem betrachtet, sondern als Teil einer intelligenten Selbstorganisation.
Die Sprache des Körpers verstehen
Gunther Schmidt arbeitet in der Therapie häufig damit, die Aufmerksamkeit der Patient:innen behutsam auf ihre körperlichen Erfahrungen zu lenken. Nicht analysierend. Nicht bewertend. Sondern neugierig.
Der Körper wird zu einer Art Landkarte innerer Prozesse.
Spannung im Brustraum
Enge im Hals
Druck im Magen
Schwere in den Schultern
All diese Empfindungen können Hinweise darauf sein, wie das innere System gerade organisiert ist. Viele Menschen haben jedoch gelernt, diese Signale zu übergehen. Der Alltag fordert Funktionieren. Leistung. Anpassung. Die Fähigkeit, die eigene Körperwahrnehmung ernst zu nehmen, geht dabei oft verloren. In der hypnosystemischen Arbeit wird sie wieder vorsichtig aktiviert. Nicht, um Symptome zu verstärken – sondern um Zugang zu den dahinterliegenden inneren Prozessen zu bekommen.
Hypnotherapie als Zugang zu inneren Ressourcen
Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist die hypnotherapeutische Nutzung von Aufmerksamkeit und inneren Bildern. Dabei geht es nicht um Showhypnose oder Kontrollverlust. Im Gegenteil. Die hypnosystemische Hypnotherapie arbeitet mit einem sehr respektvollen Verständnis von Trance. Trance wird als natürlicher Aufmerksamkeitszustand betrachtet.
Wir kennen solche Zustände aus dem Alltag:
wenn wir völlig in Musik versinken
beim Tagträumen
beim intensiven Nachdenken
oder beim Autofahren auf einer vertrauten Strecke
In diesen Zuständen wird der Zugang zu inneren Bildern, Erinnerungen und Körperempfindungen oft besonders klar. Therapeutisch kann das genutzt werden, um neue Erfahrungen im inneren System zu ermöglichen. Beispielsweise kann ein Patient eingeladen werden, die körperliche Erfahrung eines Symptoms bewusst wahrzunehmen – und gleichzeitig nach inneren Bildern oder Erinnerungen zu suchen, die mit dieser Empfindung verbunden sind. Oft zeigen sich dabei überraschende Zusammenhänge. Ein Druck im Brustkorb kann plötzlich mit einem Gefühl von Überforderung verbunden sein. Eine Spannung im Nacken mit dem inneren Anspruch, immer stark sein zu müssen. Der Körper wird so zum Wegweiser in die innere Erlebniswelt und eröffnet oft ganz neue Ansätze in der Arbeit mit dem Symptom.
Achtsamkeit statt Kampf gegen Symptome
Was Gunther Schmidts Ansatz besonders auszeichnet, ist die grundlegend wertschätzende Haltung gegenüber dem inneren System eines Menschen. Selbst Symptome, die sehr belastend sind, werden nicht abgewertet. Sie werden als Teil eines Schutzmechanismus betrachtet.
Gerade bei psychosomatischen, somatoformen und dissoziativen Störungen ist diese Haltung oft hilfreich. Viele Betroffene haben über Jahre erlebt, dass ihre Beschwerden bagatellisiert oder missverstanden wurden. Wenn ein Therapeut stattdessen sagt: „Ihr Körper versucht offensichtlich sehr intensiv, auf etwas aufmerksam zu machen“, entsteht oft zum ersten Mal ein Gefühl von verstanden werden – und sich selbst zu verstehen. Diese Form der therapeutischen Beziehung ist im hypnosystemischen Ansatz zentral. Veränderung entsteht nicht durch Druck oder Konfrontation. Sie entsteht durch Sicherheit, Würdigung und neue Erfahrungsmöglichkeiten.
Neue Kooperation zwischen Körper und Psyche
Ein wichtiges Ziel der hypnosystemischen Therapie ist es, eine neue Zusammenarbeit innerhalb des eigenen Systems zu ermöglichen. Viele Menschen erleben ihre Symptome wie einen inneren Gegner. Der Körper „macht Probleme“. Die Psyche „funktioniert nicht richtig“. Der hypnosystemische Ansatz lädt dazu ein, diese Beziehung neu zu gestalten. Statt Kampf entsteht Kooperation. Der Körper wird wieder als Verbündeter betrachtet. Ein Signal wie Herzrasen kann dann nicht nur als Angst erlebt werden, sondern auch als Hinweis: Vielleicht ist gerade eine Grenze überschritten. Vielleicht braucht es eine Pause. Vielleicht eine Entscheidung. In diesem Sinne wird der Körper zu einem Frühwarnsystem für das eigene Wohlbefinden.
Warum dieser Ansatz gerade bei psychosomatischen Erkrankungen so wertvoll ist
Psychosomatische, somatoforme und dissoziative Symptome entstehen häufig in Situationen, in denen emotionale Erfahrungen nicht ausreichend verarbeitet werden konnten. Der Körper übernimmt dann gewissermaßen eine Übersetzungsfunktion. Gefühle, Erinnerungen oder innere Konflikte finden Ausdruck in körperlichen Prozessen. Der hypnosystemische Ansatz ermöglicht es, diese Ausdrucksformen ernst zu nehmen – ohne sie vorschnell zu pathologisieren.
Statt Symptome zu unterdrücken, entsteht ein Raum, in dem ihre Bedeutung verstanden werden kann. Und oft zeigt sich dann etwas sehr Berührendes: Der Körper hat über lange Zeit versucht, für das innere Gleichgewicht zu sorgen. Auch wenn die Form dieses Versuchs manchmal sehr schmerzhaft war.
Ein zutiefst menschlicher Blick auf Heilung
Was Gunther Schmidts Arbeit so besonders macht, ist letztlich nicht nur die Methode. Es ist die Haltung. Eine Haltung, die davon ausgeht, dass Menschen – selbst in schwierigen Symptomen – über erstaunliche Fähigkeiten zur Selbstorganisation verfügen. Die Aufgabe der Therapie besteht nicht darin, Menschen zu „reparieren“. Sondern darin, Bedingungen zu schaffen, unter denen diese Fähigkeiten wieder zugänglich werden. Der Körper spielt dabei eine zentrale Rolle. Er erinnert uns daran, dass Psyche und Körper nie getrennt waren. Sie waren immer Teil desselben lebendigen Systems. Und manchmal beginnt Heilung genau in dem Moment, in dem wir beginnen, diesem System wieder zuzuhören.
Ich selbst habe den hypnosystemischen Ansatz vor fünf Jahren kennengelernt. Seitdem ist diese Art zu arbeiten – und vor allem auch diese Perspektive auf Menschen, Themen und vermeintliche Probleme – elementarer Bestandteil meiner Arbeit als Coach und Berater. Die hypnosystemische Methode nach Gunther Schmidt eignet sich nicht nur ganz hervorragend für therapeutisches Arbeiten, sondern lässt sich auch wunderbar in meine Arbeit als Coach, Mediator und Organisationsberater übertragen.
Ich bin zum großen Fan geworden, und wenn du jetzt neugierig auf hypnosystemisches Arbeiten geworden bist, kontaktiere mich gerne. Gerne können wir schauen, ob du deine Perspektive auf ein Thema, das du aktuell als problematisch erlebst, mit Hilfe des hypnosystemischen Ansatzes neu gestalten kannst, um dir so einen anderen, hilfreicheren Zugang zu erarbeiten.
Constance
Der Weg zur Heilung
Therapie - aber wie?